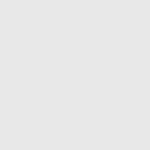|
 |
 |
HARNSTEINE BEIM MEERSCHWEINCHEN |
 |
|
|
Tierärztliche Praxis für Kleintiere
& Tierphysiotherapie
Wandsbeker Zollstraße 11
22041 Hamburg |
|
Telefon 040. 75 11 80 40
Telefax 040. 75 11 80 41
www.tierarztpraxis-wandsbek.de
www.tierphysiovet.de |
|
|
|
Erste Beschreibungen von Steinen in der Blase von Meerschweinchen stammen bereits aus dem vorigen Jahrhundert.
Geschlechtsverteilung
Es sind etwas mehr weibliche als männliche Meerschweinchen betroffen. Nach einer Studie des Harnsteinanalysezentrum Bonn, bei der von Januar 2000 bis Februar 2010 126 eingesendete Steine mittels Infrarotspektrometrie analysiert wurden, war die Geschlechteraufteilung: 46,1% weibliche Meerschweinchen, davon waren 4% kastriert; 45,2% männliche Meerschweinchen, davon 8,7% kastriert und bei den restlichen 8,7% der Meerschweinchen war das Geschlecht unbekannt.
Altersverteilung
Das durchschnittliche Meerschweinchen war 3,7 Jahre alt. Weibliche Tiere erkranken etwas später (4 Jahre) als männliche Tiere (3,3 Jahre).
|
Harnsteinarten
|
Die Mehrheit aller Steine besteht aus Kalziumkarbonat. Dieses kann in unterschiedlichen Kristallformen auftreten. Meist tritt es als Calcit oder Vaterit auf. Viele Steine haben Beimengungen (5-50%) von sogenanntem pseudoamorphem, d.h. sehr feinkristalligem Kalziumphosphat. In mehr als 13% wird auch Struvit nachgewiesen. Dies deutet auf eine begleitende Harnwegsinfektion mit Urease bildenden Keimen hin. In 8% enthalten die Steine auch Kalziumoxalat.
|
Ursachen
|
Meerschweinchen haben eine hohe intestinale Absorptionsrate für das in der Nahrung enthaltene Kalzium und Phosphat. Bei einer hohen Aufnahme von Kalzium und Phoshat durch die Nahrung steigt die renale Ausscheidung dieser Stoffe an.
Der hohe ph-Wert des Urins von ca. 8,5 begünstigt die Kristallisation.
Allgemein begünstigende Faktoren sind:
Bewegungsmangel
Übergewicht
ungenügende Flüssigkeitsaufnahme
ausschließliche Trockenfutteraufnahme
|
Was kann ich tun für mein Meerschweinchen tun?
|
1. Steinentfernung
2. Säuerungstherapie: eine kurzfristige Säuerung des Harn-pH auf 6,5 - 7 kann helfen Reststeinchen aufzulösen und sofortige Neubildung zu verhindern.
3. Zufuhr von Kalzium, Phosphat und Vitamin D mit der Nahrung kontrollieren.
4. Grün- und Saftfutter optimieren
5. Trinkwasseraufnahme optimieren
6. Harn-pH kontrollieren
7. Nach 2-3 Monaten nach Steinentfernung Nachkontrolle der Harnblase
|
Quelle
|
Praxisliteratur
Wikipedia
Harnsteinanalyszentrum Bonn
|
 Urogenitaltrakt Urogenitaltrakt
|
Druckbare Version
|